Als Chefredakteur des legendären Merve-Verlags und Mitbegründer des Spekulative Poetik-Projekts sowie der Kulturinstitutionsberatung Bureau for Cultural Strategies ist Armen Avanessian tongebend für eine zeitgenössische Philosophie, die abseits des akademischen Feldes nach neuen Beteiligungs- und Ausdrucksformen sucht. In Anschluss an seinen Vortrag zu institutionellem Realismus beim ZU-Symposium “Krisen der Realität” hat er mit Donna Schons über seine Arbeitspraxis gesprochen. Wie sieht das aus, wenn Philosophen, wie im tagebuchhaften Werk “Miamification” beschrieben, “in der Kunst überwintern”?
Bei deinem Vortrag vorhin erwähntest du, dass du dich hier von Ästhetik umgeben fühlst – was genau meinst du damit?
Der Kunstdiskurs und auch der philosophische Diskurs – zumindest in Deutschland – ist sehr von Ästhetik dominiert. Für mich ist das nicht nur ein historisches Phänomen oder Problem, sondern beeinflusst ganz konkret, wie über Kunst nachgedacht wird und worüber eben nicht nachgedacht wird. Der Fokus liegt auf ästhetischer Erfahrung und auf Objekten – es gibt eine Rezeptionsästhetik, aber das Schaffende, das Poetische, das Hervorbringende ist gar nicht so sehr Teil der Überlegungen, und dieses Manko merkt man auch daran wie Theorie gemacht wird, an der Praxis der Theorie. Das Problem ästhetischer Ansätze ist zudem, dass sie oft keine Antworten für unsere heutige Lage bietet. Trump, der tweetet beziehungsweise schreibt, Big Data – das sind alles keine wahrnehmbaren, ästhetischen Probleme, sondern wie ich finde eher Gegenstand einer sprachphilosophisch oder semiotisch informierten Poetik.
Mit Projekten wie dem Film Hyperstition, der Begleitung deiner Texte durch Andreas Töpfers Speculative Drawings und den an deinen Denkstrukturen orientierten Layouts deiner Bücher übersetzt du deine Ideen aber trotzdem ins Ästhetische, oder?
Das würde ich nicht so formulieren, beziehungsweise liegt ja gerade hier das Problem: Dass wir alles was mit Kunst zu tun hat unter Ästhetik subsumieren. So funktioniert Ideologie – dass wir gar nicht mehr sehen, wo die blinden Flecken sind. Wer sagt denn, dass einen Film zu machen eine ästhetische Praxis ist? Warum ist es nicht eine poetische Praxis? Für mich ist es vielmehr ein Machen – etwas anderes als ein reines Ästhetisieren oder Wahrnehmen. Mich interessiert die Kunst sehr, aber ich schreibe nicht über Kunst. Mich interessieren weniger die Objekte, sondern vielmehr Schaffens-, Produktions- und Distributionsprozesse: Wie verbreitet sich ein Text? Wie verbreitet sich ein Text in Verbindung mit Bildern? Wie kann ich Ideen anders als nur sprachlich ausdrücken, beziehungsweise was sind nicht-sprachliche Gedanken? Das sind für mich poetische Fragen, und keine Fragen der Wahrnehmung und ästhetischen Erfahrung von Objekten.
Wobei sie ja auch eine gewisse Objektdimension beinhalten.
Das altgriechische poesis bedeutet ja Schaffen, das Herstellen von etwas. Das hat natürlich auch etwas mit Objekten zu tun, auf jeden Fall. Aber es geht nicht um deren Schönheit. Es geht mir unter anderem darum, welche Dissonanz zwischen einem Text und einem Bild hergestellt wird, nicht darum, dass eines das andere übersetzt und verdoppelt. Und es ist letzlich auch ein poetisches Experimentieren damit, was es heißt, Theorie und Philosophie im Kunstfeld zu machen und sich nicht einfach in der Rolle wohlzufühlen, in der man steckt. Die Position, aus der man spricht und das Feld, in dem man sich befindet, ständig zu verfremden.

Ist das auch der Hauptgrund für dich gewesen, mit deiner philosophischen Praxis in die Kunst zu gehen?
Ich bin weniger in die Kunst gegangen, als dass ich wie viele andere Theoretiker gezwungen bin, im Kunstfeld zu arbeiten. Wenn man neue philosophische Theorien macht, dann finden die zu 90 Prozent nicht an philosophischen Fakultäten statt. Wenn man sich die Rezeption von Dekonstruktion, Focault, Deleuze und so weiter ansieht, fand die in Amerika vor allem in den Studies – Gender Studies, Film Studies, Literature und English Departments – statt. Und auch heute noch gibt es in Deutschland glaube ich keinen Deleuzianer, der an einer philosophischen Fakultät eine Professur hat. Für meine Generation ist es selbst in den Literaturwissenschaften immer schwieriger, interessante Philosophie aktiv zu betreiben – deshalb gibt es diese Abwanderung in den Kunstbereich.
Der Kunstbereich ist da also offener und aktueller?
Das ist natürlich alles sehr prekär, aber ja, zumindest braucht der Kunstbetrieb ständig neue Theorie, die er natürlich anders bearbeitet, anders verdaut oder nicht verdaut – viele sagen oberflächlicher, ich würde einfach sagen anders verarbeitet. Und ich gehöre zu einer Generation an Theoretikern, die eben nicht achtzig Jahre alt sind, eine Professur in Frankreich innehaben, schon zehn Bücher geschrieben haben und dann auf einmal von Künstlern entdeckt wurden. Ich habe noch etwas Zeit vor mir, in der ich irgendwie ökonomisch überleben muss und muss mich sozusagen mit diesem Kunstfeld arrangieren. Es ist ein experimenteller Selbstversuch: ich versuche, Mittel zu finden, um mit ihm umzugehen, die produktiver sind als die berühmt berüchtigten kritischen Katalogtexte zu schreiben, die behaupten, dass Künstler soundso hochpolitisch ist, aber de facto nur dafür sorgen, dass Karrieren und Verkaufspreise in die Höhe schnellen.
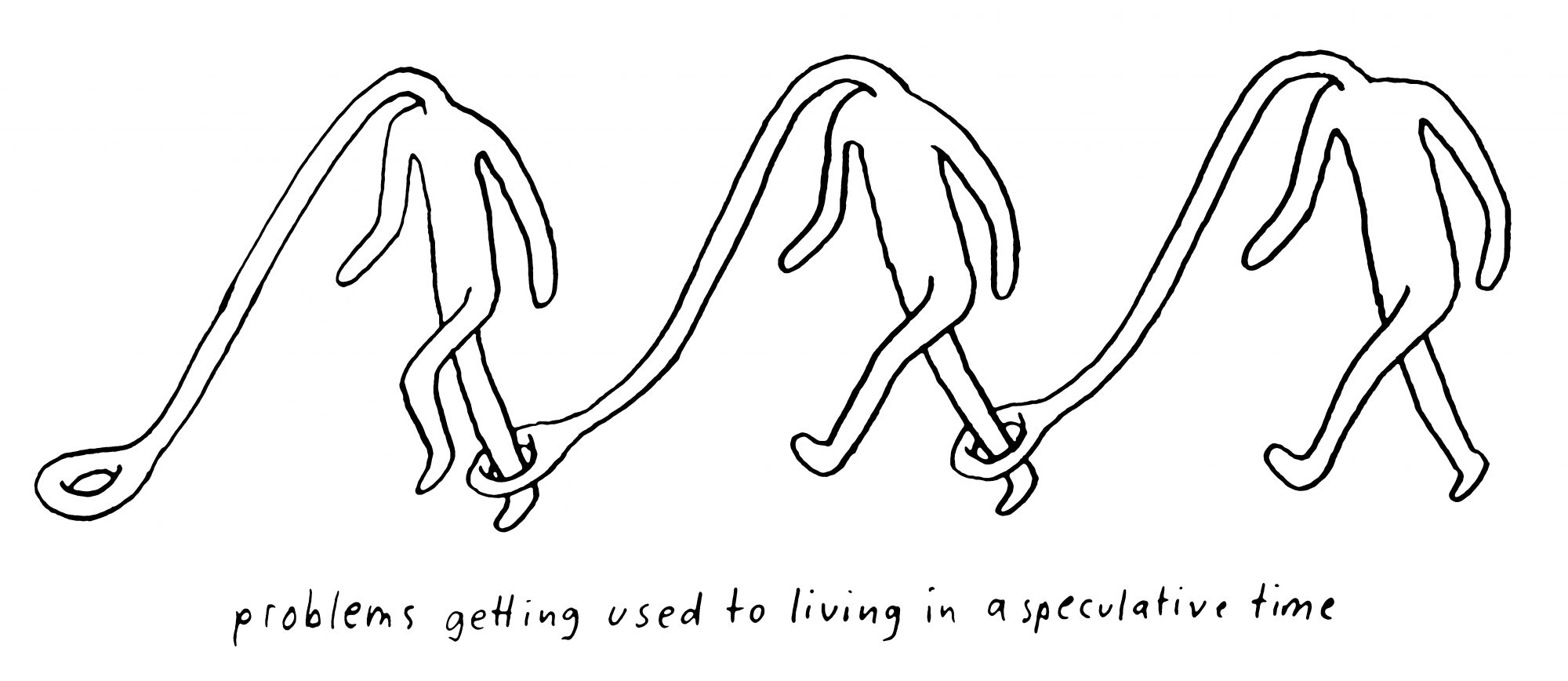
DISCREET, dein Beitrag zur vom Künstlerkollektiv DIS organisierten Berlin Biennale war ein solcher Versuch. Diese “Security Agency For The People”, die nach Möglichkeiten suchte, Methoden nationaler Überwachungsdienste in den Dienst der Bürger zu stellen, diente primär der Ideenentwicklung. Wie hat sich das Projekt nach dem Ende der Biennale noch weiterentwickelt?
Vor allem mal war das ein Experiment mit der Aufmerksamkeitsökonomie und dem Theoriebedarf einer Biennale, die über Wochen läuft. Wie kann man dafür ein Theorieformat entwickeln, ein Gedanken- und Ideenproduktionsformat für eine politische Theorie? Letztlich war das auch verbunden mit finanziellen Fragen: wie kann man solche Projekte länger aufrechterhalten? Ich bin mit einigen Leuten in Kontakt und zahlreiche der mit DISCREET verbundenen individuellen Projekte laufen auch weiterhin. Aber woraus ich am meisten gelernt habe war, wie man so ein größeres Projekt aufstellen und finanzieren muss und wie weit im Voraus man es planen muss, damit es auch Folgewellen und längerfristige Arbeiten nach sich zieht. Nachhaltigkeit ist im Kunstfeld ein großes Problem. Unis bieten einem eine bestimmte Konstanz, aber unmögliche Arbeitsbedingungen, um experimenteller zu arbeiten. Im Kunstbereich hat man umgekehrt manchmal mehr experimentelle Möglichkeiten, aber die Arbeitsweise ist eher projektbezogen: mach’ eine Tagung, unterrichte ein Semester, arbeite mit einem Künstler zusammen. Ich arbeite jetzt gerade an The Recalibrated Institution, einem anderen Projekt mit zehn Leuten in einer Residency, in der es um alternative Konzepte speziell für Kunst- und Kulturinstitutionen geht. Und da planen wir von Anfang an: wie können wir weiterarbeiten, sobald diese drei, vier Monate vorbei sind? Es ist sozusagen immer auch ein Arbeiten und Experimentieren in den Infrastrukturen und über die Infrastrukturen und Plattformen, in denen sie stattfinden.
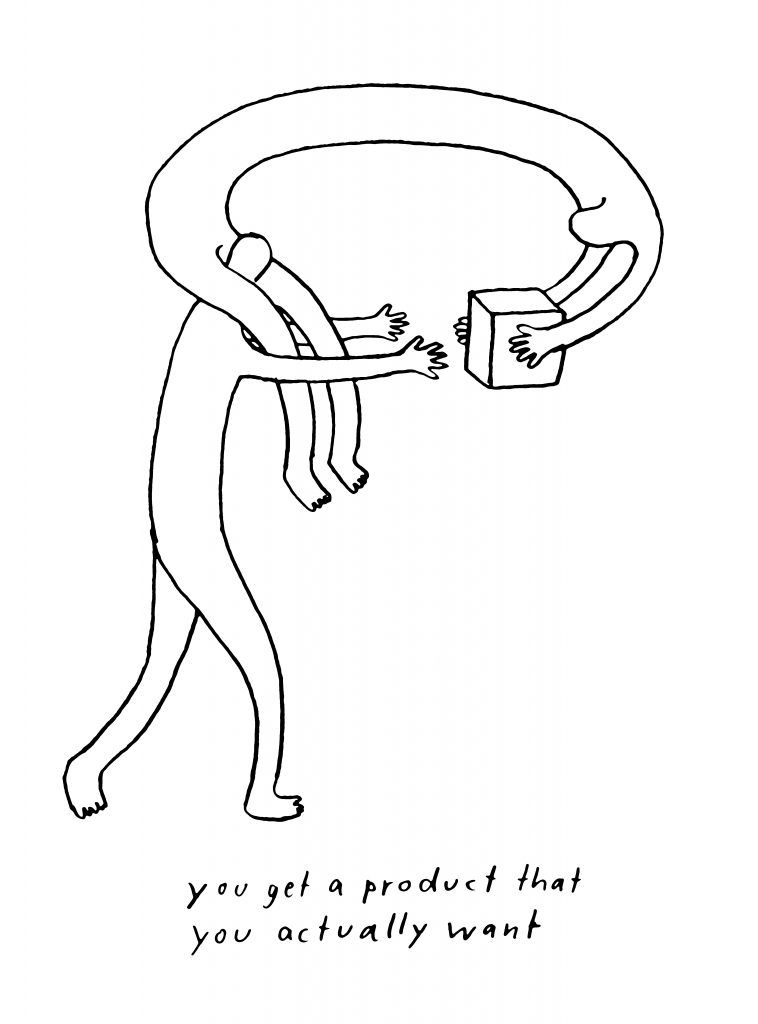
Was mir beim Lesen von Kritiken der Berlin Biennale aufgefallen ist, war der immer wieder auftauchende Vorwurf der Ironie und des Zynismus – obwohl es solche Arbeiten wie DISCREET, New Eelam von Christopher Kuledran Thomas oder Blockchain Visionaries von Simon Denny gab, die konstruktiv an politische Fragen unserer Zeit herantraten. Meiner Meinung nach finden sich in all diesen Arbeiten Einflüsse des Akzelerationismus. Ist die vorschnelle Wahrnehmung als zynisch oder gar ironisch ein Problem dieser Denkschule, oder eher ein Wahrnehmungsproblem ihrer Rezipienten?
Zunächst einmal habe ich schon bevor die Biennale losging mit den Leuten von DIS Witze darüber gemacht, wie sie rezipiert werden wird und wer sie wie finden wird. Ich glaube nicht an die Objektivität und Neutralität des Kunstbetriebs. Das ist einfach auch ein ökonomischer Machtkampf, in dem bestimmte Interessen verfochten werden – die Zeitschriften und ihre Kunstkritiker stehen sozusagen mit den inserierenden Galerien und Museen im Bund, und je nachdem mit welchen Kuratoren sie befreundet sind finden sie einiges eher gut und kritisch und übersehen ganz offensichtlich anderes. Das ist der eine Aspekt, warum einige wenige – generell war die Rezeption ja erstaunlich positiv – die Biennale als zynisch aufgefasst haben.
Zur Frage des Akzelerationismus: den gibt es ja als einheitliche Position nicht. Aber nicht nur die Arbeiten, über die du da sprichst, sondern auch viele frühe Werke wie John Knights Institutionskritik der 70er Jahre, waren wie ich sagen würde akzelerationistische Projekte – und in ihrer Zeit schwer umstritten, weil sie ein von den Zeitgenossen als Entfremdung empfundene Dimension aufgespürt und noch weiter getrieben haben. Dass jede provokative Arbeit, die nicht offensichtlich mit einem moralistisch-humanistischen Gestus auftritt, als zynisch aufgefasst wird, ist also nichts neues. Das ist dem Akzelerationismus genauso passiert: Obwohl direkt in der ersten Zeile des von mir herausgegebenen #Akzeleration-Bandes steht, dass es dabei nicht darum geht, Dinge zu beschleunigen, wird er trotzdem so aufgenommen.
Ich bin ja ein Fan von Focault und lese immer wieder gerne die Interviews mit ihm – was der sich alles hat anhören müssen! Dass er die Psychoanalyse mit dem Viktorianismus gleichstellt, dass er den Marxismus und den Humanismus zunichte macht, dass er in Wirklichkeit reaktionär ist, weil er irgendwelchen Naivlingen, von denen heute niemand mehr spricht, ein paar liebe Illusionen geraubt hat. Genau die Vorwürfe, die Focault entgegengebracht wurden, kommen jetzt von Focault-inspirierten Leuten. Die scheinen historisch nicht genug nachzulesen. Wenn man bestimmte Illusionen kritisiert oder ankränkelt, gibt es anscheinend sofort den Zynismus-Vorwurf. Ich glaub, der Nebel wird sich lüften. Für mich sind die Akzelerationismus-Bände Teil eine Publikationsbuchreihe, die ich bei Merve herausbringe und mit der ich versuche, jedes Jahr etwas in den Diskurs hineinzuwerfen, auch um eine Debatte zu provozieren. Der erste Band entstand vor genau vier Jahren, wie auch in der Einleitung erwähnt, als Beitrag zum politischen Stillstand in Deutschland – als schon eine große Koalition absehbar war, die politisch nicht viel weiterbringt.
Was ja heute angesichts der Jamaica-Koalition nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Dass der Akzelerationismus so viel Aufmerksamkeit bekommt, war für mich ja auch nicht absehbar. Für mich war das zu der Zeit einfach nur der Versuch, wieder ein paar andere Namen reinzubringen, etwas anderes in den Diskurs einzuschleusen und nicht einfach immer nur die akademischen Machthoheiten sprechen zu lassen. Ich finde es gut, wenn füfnunddreißigjährige PhD-Studenten in dreißig Sprachen übersetzt, rezensiert, rezipiert und diskutiert werden. Das ist eine politische Aufgabe als Theoretiker: nicht nur Theorie und Inhalte zu produzieren, sondern auch die Art und Weise, wie man arbeitet, mit wem man arbeitet, mit welchen Plattformen und wie inklusiv man arbeitet. Aber einfacher ist es natürlich über Foucault und Rancière zu dissertieren und habilitieren als mit deren Theorie Ernst zu machen.
Du siehst dich also nicht als “-isten”?
Nein, wenn du dir den Akzelerationismus-Band ansiehst, sind die Hälfte der darin aufgeführten Positionen dagegen. Das hindert natürlich niemanden daran, mit Stempeln durch die Welt zu laufen uns jeden, der etwas herausgibt, damit abzustempeln. Dann bin ich eben auch ein Xenofeminist, ein spekulativer Realist, ein Ich-weiß-nicht-was. Ich versuche ja auch, damit zu spielen. Als ich gemerkt habe, dass die Rezeption im Kunstbereich so verläuft, habe ich begonnen, das auf eine humoristische Art zu übersteigern. Der Hashtag vor dem Buchtitel zum Beispiel war ein Weg, diese Konzepthungrigkeit zu bedienen, aber auf eine spiegelvorhaltende Weise. All das ermöglich es mir aber das zu tun, worauf es mir eigentlich ankommt, nämlich meine Bücher zu schreiben und auf experimentelle Weise darüber nachzudenken, was das denn überhaupt ist, das Philosophieren.
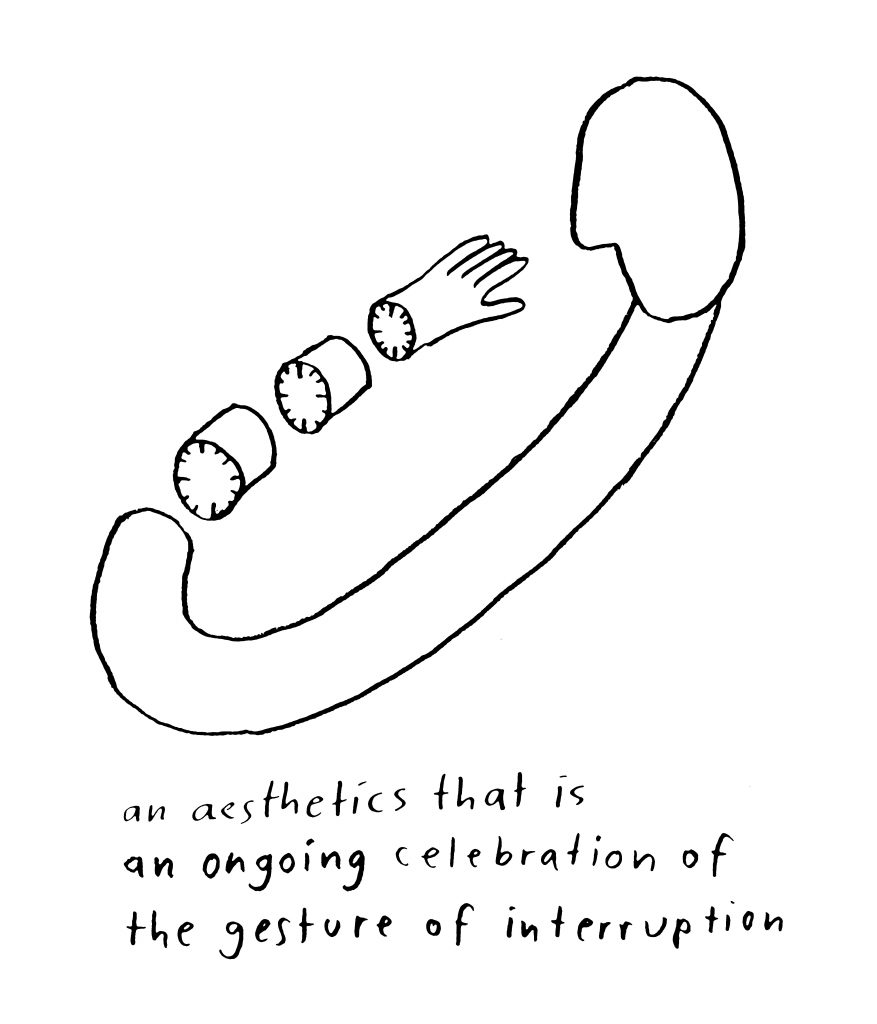 In “Miamification” sprichst du von der “Beschleunigung als Zwang” und wie sich diese auf unsere Medienrezeption, aber auch auf unsere Medienproduktion auswirkt. Wie schreibst und arbeitest du selbst unter diesen Bedingungen?
In “Miamification” sprichst du von der “Beschleunigung als Zwang” und wie sich diese auf unsere Medienrezeption, aber auch auf unsere Medienproduktion auswirkt. Wie schreibst und arbeitest du selbst unter diesen Bedingungen?
Man muss da zunächst mal unterscheiden von der persönlichen lebensweltlichen Beschleunigung, von der ich nicht unbedingt ein Fan bin. Auf der anderen Seite bin ich ständig online und habe gerade mehrere Buchabgaben und Sammelbänder und Übersetzungen anstehen. Man ist halt trotzdem produktiver mit diesem iPhone und mit dem ständigen Onlinesein, gerade wenn man auf mehreren Kontinenten an unterschiedlichen Projekten arbeitet.
“Miamification” war ein Spezialfall, weil ich inzwischen immer seltener Zeit habe, konzentriert länger dazusitzen und ein Buch zu schreiben. Deshalb kam im Flugzeug, sobald zum ersten Mal wieder etwas Ruhe war, eine Lust am Schreiben zurück. Dazu kam ein wirklich interessanter und irritierender Kontext, nämlich Miami, und plötzlich hat sich dieses an den ersten Tagen eher tagebuchhafte und unschuldige Notizenmachen immer mehr ausgeweitet zu einem Buchschreibeexperiment.
Eigentlich hätte ich gerne einen Job und Ruhe. Es gibt einem hin und wieder einen Kick, pro Monat in fünf Länder zu reisen und an prestigeträchtigen Institutionen zu sein, und es ist jetzt nicht so dass ich schon ausgebrannt bin. Nur ist es auch nicht mein Lebensziel, weiterhin in diesem extrem hektischen Rhythmus zu leben und ständig von einem Ort zum anderen zu fahren. Letztendlich bin ich ein Philosoph, und das impliziert einen bestimmten Habitus des Lesens, des Recherchierens, des Nachdenkens. Es gibt natürlich unterschiedliche Talente, aber ob du’s glaubst oder nicht: ich befürchte ich arbeite besser, wenn ich einfach meine Ruhe habe. Aber ich lass’ mich nicht unterkriegen. Wenn’s schwierig wird, mache ich selbst aus zweieinhalb Wochen Miami irgendetwas. Man darf kein Ressentiment, keine traurigen Affekte, wie Spinoza das nennt, entwickeln. Ich habe zwar leider keinen akademischen Job, aber produktiver als die meisten Akademiker bin ich trotzdem. Und wenn ich daran denke dann verschwindet meist jedweder Ärger oder Zorn.
Es gibt natürlich auch die Alternative, sich der Beschleunigung und den sozialen Medien komplett zu verweigern.
Und wer zahlt dann meine Miete? Eine Professur habe ich nicht, und wenn ich dann arrogant sage, die Kunstwelt ist mir zu oberflächlich, das ständige Herumreisen ziemt sich nicht für einen ernsten, tiefsinnigen Philosophen… Das ist eine ganz banale ökonomische Frage. Wenn mir jemand einen Job in Friedrichshafen anbietet, bin ich übermorgen hier.
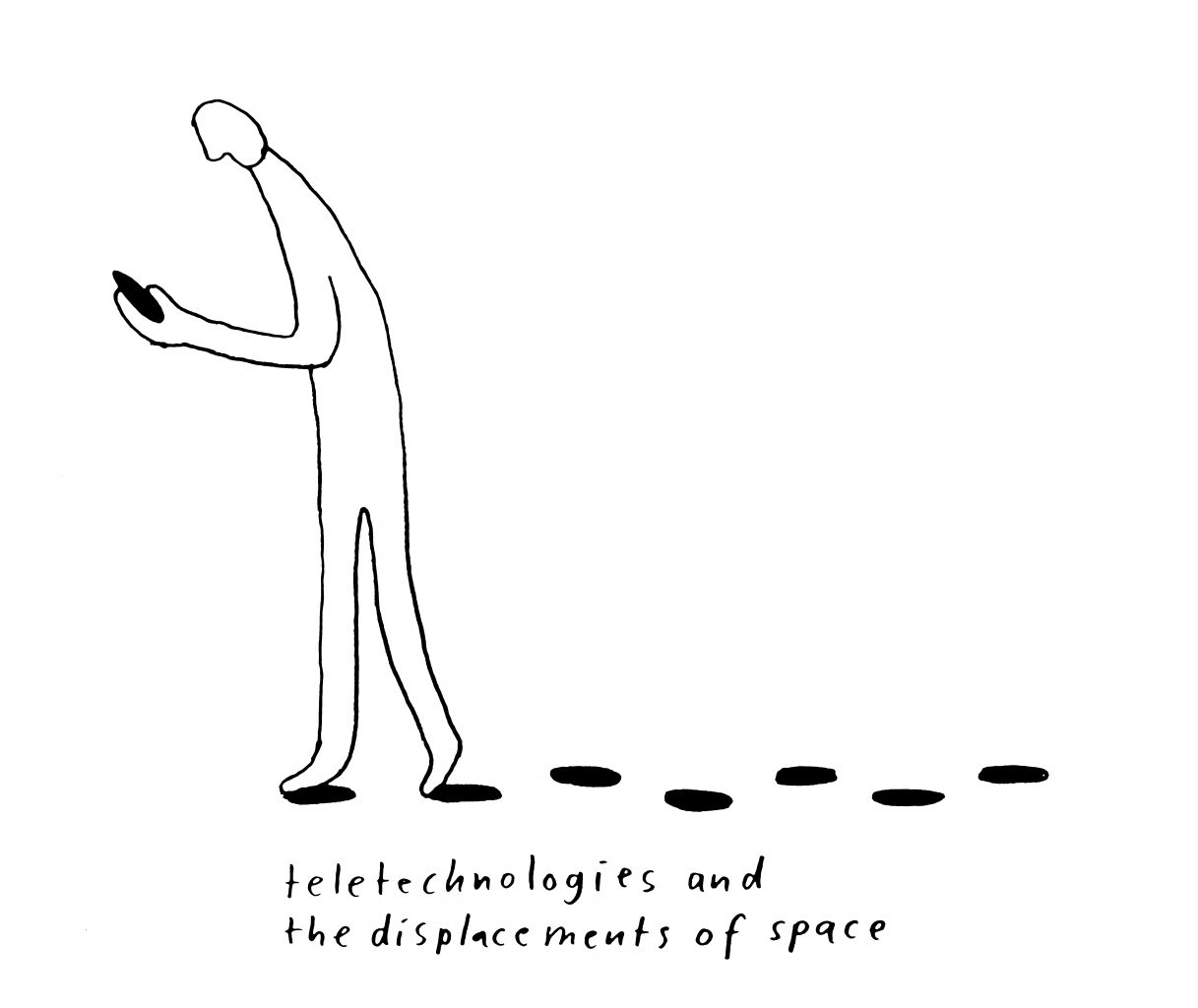
Also ist deine rege Nutzung von Twitter, Facebook und Instagram rein ökonomisch begründet?
Vor fünf Jahren war ich noch nicht auf Facebook. Ich habe mich dort angemeldet, als ich mein Forschungsprojekt über Spekulative Poetik entwickelt habe gemeinsam mit Anke Hennig und Events hatte, zu denen ich unter Anderem Quentin Meillassoux eingeladen hatte. Da waren dann nur 12 Personen an der Freien Universität, kein einziger Philosoph, kein einziger meiner Kollegen – drei dänische Kuratoren, zwei italienische Künstlerinnen, und so weiter. Ich hab’ gemerkt, ich muss diese Leute irgendwie erreichen, statt auf Interesse meiner akademischen Kollegen zu hoffen. So bin ich zu Social Media gekommen. Einmal am Tag sende ich auf Facebook eine Message ab, die immer irgendetwas professionelles ist, nichts privates. Natürlich geht es mit wie jedem anderen Menschen machmal nicht gut, werde ich krank, finde bestimmte Sachen lustig oder nicht, habe politische Ansichten – aber an dieser neurotischen Facebook-Emotionsspirale versuche ich mich nicht zu beteiligen, sondern ich nutze es einfach als Kommunikations-Plattform.
Gemeinsam mit Victoria Ivanova hast du das Beratungsbüro Bureau for Cultural Strategies gegründet. Kannst du mir zum Abschluss noch ein wenig darüber erzählen?
Im Umgang mit dem Kunstbetrieb, aber auch mit dem intellektuellen Betrieb und mit mir selber versuche ich immer, Probleme zu identifizieren und wirklich praktisch etwas anders zu machen. Ich habe ein Problem mit der Uni gehabt, also habe ich versucht, anders zu publizieren und ein Buch über die Uni zu schreiben – nicht nur bei Feierabend mit Freunden darüber zu raunzen, was falsch läuft, und danach genauso weiterzumachen ein Leben lang. Daraufhin war ich irgendwann nicht mehr Teil der Uni, ich glaube weil die das nicht allzu sehr goutiert hat.
Dann habe ich begonnen, im Kunstfeld und sogar selbst künstlerisch zu arbeiten. Im Kunstfeld habe ich dann gelernt, dass Veränderung nur möglich ist, wenn man längerfristig im Rahmen der Infrastrukturen mit Insitutionen zusammenarbeitet. Das kann nicht über reine Content-Produktion funktionieren – dass ich einen Vortrag halte oder irgendwo zwei Wochen unterrichte. Das Bureau for Cultural Strategies ist etwas, mit dem ich versuche darauf zu reagieren und auch selber zu lernen, welches Know-How, welche Wissensformen, welche Praktiken, welche Techniken ich mir aneignen muss, um mit Kultur- und Kunstinstitutionen in einen anderen Austausch zu kommen und etwas an deren grundsätzlichen Parametern zu verändern. Ich habe die ganz starke Überzeugung, dass Institutionen sehr wichtig sind und dass sie viel mehr Power und Leverage haben, als sie selbst wissen. De facto sehen sie sich aber meist nur als passive Opfer des Neoliberalismus, des Finanzkapitalismus. Das sind sie sicher auch, aber sie sehen nicht, dass sie zugleich Teil des Problems sind, was auch heißt, dass sie ein ungeheueres Potenzial haben. Die Leuten, die dort arbeiten, das ungeheure Wissen, das sich dort sammelt, aber auch die realen Effekte, die von Institutionen ausgehen – so etwas wie Gentrifikation, so etwas wie die Ausbildung von jungen Leuten und den Praktiken, die diese dann in die Wirtschaft und in andere Felder tragen – all das kommt den Institutionen selber überhaupt nicht zu Gute, weil sie gar nicht wissen, was sie da an potenziellem Mehrwert produzieren. Und das ist die Idee hinter dem Bureau, die ich einen institutionell realistischen Ansatz nenne: sich darauf zu konzentrieren, was die realen Effekte des Kunstbetriebs, einer Konsthochschule, eines Museums sind – und nicht darauf, welche großartige genozidkritische Skulpturausstellung dieses oder jenes Museum gemacht hat. Weil die realen Effekte möglicherweise ganz andere sind und viel eher damit zu tun haben, ob diese Kunst jetzt bei Gagosian hängt, auf der Art Basel Miami ausgestellt wurde und so weiter.

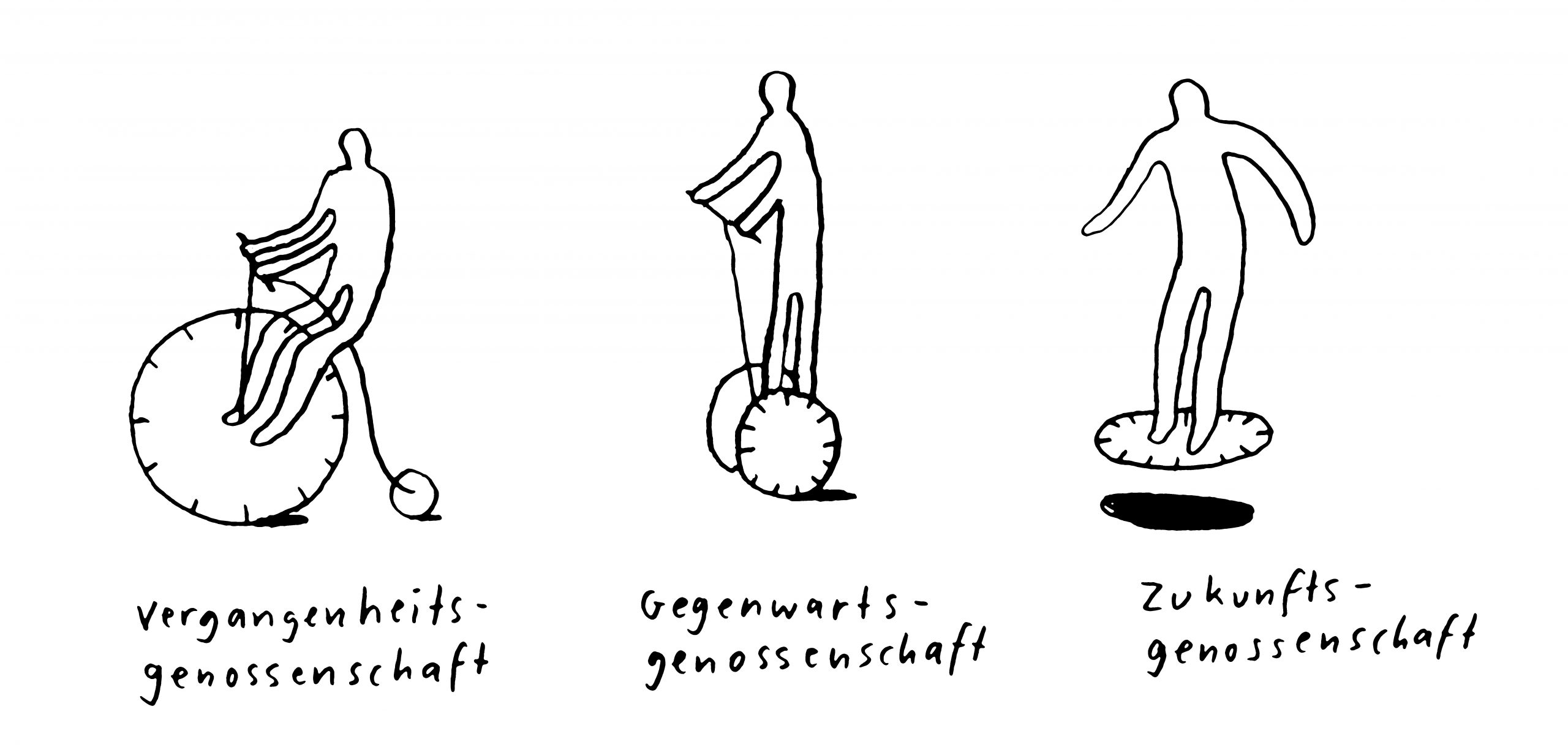
1 Comment